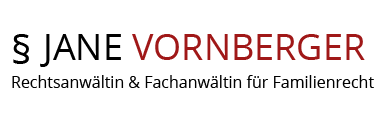Die persönliche Anhörung in einem Betreuungsverfahren dient nicht nur der Gewährung rechtlichen Gehörs, sondern hat vor allem den Zweck, dem Gericht einen unmittelbaren Eindruck von dem Betroffenen zu verschaffen. Ihr kommt damit auch in den Fällen, in denen sie nicht durch Gesetz vorgeschrieben ist, eine zentrale Stellung im Rahmen der gemäß 26 FamFG von Amts wegen durchzuführenden Ermittlungen zu .
Allein die Tatsache, dass der Betroffene sich dahingehend äußert, eine Betreuung nicht haben und mit einem möglichen Betreuer nicht zusammen arbeiten zu wollen, genügt nicht, um die Erforderlichkeit der Betreuung entfallen zu lassen.
BGH, Beschluss v. 29.6.2016, XII ZB 603/15