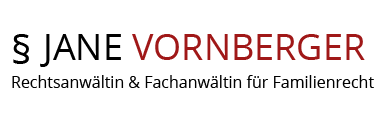Die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey startet wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Notfall-Kinderzuschlag (KiZ) für Familien mit kleinen Einkommen. Die bereits bestehende Familienleistung Kinderzuschlag unterstützt Familien, in denen der Verdienst der Eltern nicht für die gesamte Familie reicht. Etwa 2 Millionen Kinder sind antragsberechtigt, weil ihre Eltern kleine Einkommen haben. Pro Kind kann kan monatlich […]
Bei Fragen nehmen Sie bitte per E-Mail (Kanzlei.Vornberger@t-online) per Telefon (06021-90 17 450) mit mir Kontakt auf. Vielen Dank und alles Gute!
Der Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen in einem Ehegattentestament durch Vernichtung der Urkunde setzt voraus, dass beide Ehegatten mit Testier- und Widerrufswillen an der Vernichtung der Urkunde mitgewirkt haben.
An den diesbezüglichen Nachweis sind hohe Anforderungen zu stellen. Er setzt insbesondere voraus, dass die Möglichkeit, dass ein Ehegatte die Urkunde ohne Kenntnis und Mitwirkung des anderen vernichtet hat, ausgeschlossen werden kann.
OLG München, Beschluss vom 31.10.2019 – 31 Wx 398/17
Ein Testament ist widerrufen, wenn es mit dieser Absicht vernichtet wurde. Bei einem Ehegattentestament müssen beide Eheleute widerrufen wollen. Derjenige, der aus dem Widerruf eines Testaments Rechte herleiten möchte muss diesen Widerruf beweisen. Steht die Vernichtung der Urkunde nicht fest, sondern ist sie lediglich unauffindbar gilt dies ebenso. Es besteht keine Vermutung dass die Urkunde von dem Erblasser vernichtet worden und damit als widerrufen anzusehen ist. Dies setzte voraus, dass die Vernichtung der Urkunde festgestellt ist. Die Unauffindbarkeit begründet keine tatsächliche Vermutung oder einen Erfahrungssatz, dass das Testament durch den Erblasser vernichtet worden ist.
Zutreffend ist das Nachlassgericht davon ausgegangen, dass derjenige, der aus dem Widerruf eines Testaments Rechte herleiten will, diesen Widerruf zu beweisen hat. Dieselben Grundsätze gelten dann, wenn – wie vorliegend – die Vernichtung der Urkunde selbst nicht feststeht, diese vielmehr lediglich unauffindbar ist.
Mithin muss das Gericht positiv davon überzeugt sein, dass das Testament in Widerrufsabsicht durch die Ehegatten vernichtet wurde. Für diesen Beweis genügt grundsätzlich, da eine absolute Gewissheit nicht zu erreichen und jede Möglichkeit des Gegenteils nicht auszuschließen ist, ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit , der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen.
Unterlässt der nach §§ 564 S. 1, 1922 I BGB in das Mietverhältnis eingetretene Erbe, dieses nach § 564 S. 2 BGB außerordentlich zu kündigen, liegt allein hierin keine Verwaltungsmaßnahme, welche die nach Ablauf dieser Kündigungsfrist fällig werdenden Verbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis zu Nachlasserbenschulden bzw. Eigenverbindlichkeiten werden lässt, für die der Erbe – auch – persönlich haftet.
Eine persönliche Haftung tritt jedoch etwa dann ein, wenn der Erbe nach wirksamer Beendigung des Mietverhältnisses seiner (fälligen) Pflicht aus §§ 546 I, 985 BGB zur Räumung und Herausgabe der Mietsache nicht nachkommt
s. a. BGH, Urteil v. 25.9.2019 – VIII ZR 138/18
Einsichtsrecht eines Miterben ins Grundbuch zur Klärung von Ausgleichspflichten nach §§ 2050 ff. BGB Ein Miterbe kann ein berechtigtes Interesse an umfassender Grundbucheinsicht in ein früher dem Erblasser gehörendes Grundstück haben, wenn Ausgleichsansprüche gegen einen Miterben nach § 2050 ff. BGB in Betracht kommen. Zur Klärung von Ausgleichspflichten nach §§ 2050 ff. BGB sind dem Miterben Auszüge aus den Grundakten zu erteilen, wenn nicht die schutzwürdigen Interessen des eingetragenen Eigentümers überwiegen.
s. auch OLG Braunschweig, Beschluss vom 11.06.2019, AZ: 1 W 41/19
Gehören zum angemessenen Unterhalt (§ 1610 Abs. 1 BGB) Kosten für eine In-ternatsunterbringung sowie hierbei anfallende Nebenkosten für Lehrmittel, Ausflüge, Kopien, Bastelbedarf sowie Materialien für eine Legastheniethera-pie, handelt es sich nicht um Sonderbedarf, sondern um Mehrbedarf, der aus dem Elementarunterhalt aufzubringen ist.
Der Mehrbedarf ist dann zu leisten, wenn er als berechtigt anzuerkennen ist. Grundsätzlich darf derjenige Elternteil dem die elterliche Sorge oder der Teilbereich der schulischen Angelegenheiten obliegt über eine Internatsunterbringung entscheiden. Der barunterhaltspflichtige Elternteil muss eine solche Entscheidung grundsätzlich hinnehmen, auch wenn sie sich kostensteigernd für ihn auswirkt und sie ihm nicht sinnvoll erscheint. Deshalb können im Unterhaltsverfahren Maßnahmen des insoweit sorgeberechtigten Elternteils grundsätzlich nicht auf ihre Rechtmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit überprüft werden. Allerdings müssen die Mehrkosten angemessen sein. Entscheidend ist neben den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Barunterhaltspflichtigen, ob eine kostengünstigere Alternative zu der gewählten Schulform existiert, die einen vergleichbaren Erfolg verspricht. Es müssen gewichtige Gründe vorliegen, die den Besuch der teureren Einrichtung rechtfertigen. Zu prüfen ist ferner, ob andere Möglichkeiten zur schulischen Förderung des Kindes bestehen und zumutbar sind, die bei geringeren Kosten zu vergleichbaren Erfolgen führen würden.
s.auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.05.2019, AZ 20 UF 105/18
Wenn ein Familienangehöriger auf Grund einer Vorsorgevollmacht Geldgeschäft fü ein anderes Familienmitglied erledigt, geht man in der Regel von einem Auftrag mit rechtlicher Verpflichtung zu Rechnungslegung aus entschied das OLG Brandenburg in seinem Urteil vom 02.04.2019
Geht es um wesentliche Interessen – bei Interessen wirtschaftlicher Art ist immer davon auszugehen -, muss ein Auftragsverhältnis angenommen werden und es kann nicht von einem Gefälligkeitsverhältnis ausgegangen werden. Das persönliche Vertrauensverhältnis schließt einen Auftrag nicht aus. Zum einen ist das Vorhandensein von persönlichem Vertrauen Voraussetzung für die Erteilung eines Auftrags. Zum anderen ist aus dem Vorhandensein des Vertrauens kein Rückschluss auf die Entbehrlichkeit der Rechenschaft zulässig.
(siehe auch: OLG Brandenburg, Urteil vom 2.4.2019, 3 U 39/18, http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE212932019&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
Der BGH hat am 18.06.2019 entschieden, dass eine Schenkung an das Schwiegerkind unter bestimmten Voraussetzungen zurück gefordert werden kann. Allerdings geht das Gericht anders als früher nun davon aus, dass entweder die Schenkung ganz oder aber gar nicht zurück gefordert werden kann. Eine anteilige Rückforderung, weil das eigene Kind und dessen Lebenspartner sich erst längere Zeit nach Scheunkung trennten. Die Schwiegereltern hätten bei Kenntnis gar nicht und nicht ein bisschen geschenkt.
In dem zu entscheidenden Fall hatte die Schwiegereltern dem Lebenspartner 50.000 EURO zum Hausbau geschenkt. Der BGH hielt die Rückforderung für gerechtfertigt, weil die Lebensgemeinschaft schon 2 Jahre nach Schenkung beendet wurde.
Der personensorgeberechtigte Elternteil, der Inhaber der elterlichen Sorge ist, hat auch wie der umgangsberechtigte Elternteil in entsprechender Anwendung der §§ 1632 Abs. 1, 1684 Abs. 2 BGB grundsätzlich einen Anspruch auf Herausgabe des Kinderreisepasses. Der Pass ist dann herauszugeben, wenn er zur Ausübung des
Der Herausgabeanspruch besteht nur insoweit, als der berechtigte Elternteil für die Ausübung seines Rechts den Kinderreisepass benötigt.
Die berechtigte Besorgnis, dass der die Herausgabe begehrende Elternteil mit Hilfe des Kinderreisepasses seine elterlichen Befugnisse überschreiten (etwa das Kind ins Ausland entführen) will, kann dem Herausgabeanspruch entgegenstehen.
siehe auch:http://BGH, Beschluss vom 27.04.2019, AZ XI ZB 345/18
Eine unverheiratete Mutter verliert ihren Unterhaltsanspruch gegen den Vater ihres Kindes nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt nicht, wenn sie eine neue feste Beziehung eingeht, selbst wenn sie einen gemeinsamen Hausstand mit dem neuen Partner gründet.
Soweit der Vater eine Unterhaltsverwirkung wegen der Lebensgemeinschaft mit ihrem neuen Partner annehme, sei dem nicht zu folgen. Der Grundgedanke der Unterhaltsverwirkung (§ 1579 Nr. 2 BGB) sei auch nicht über den Gleichheitssatz (Art. 3 GG) auf Unterhaltsbeziehungen unter nichtehelichen Partnern anzuwenden.
Insbesondere folge aus dem Gleichheitssatz nicht, dass für eine Verwirkung bereits eine „einfache“ Unbilligkeit im Sinne des aus dem Ehegattenunterhaltsrecht stammenden Grundsatzes einer Unterhaltsverwirkung (§ 1579 BGB) ausreiche.
Hintergrund für die Verwirkung wegen des Zusammenlebens in „sozio-ökonomischer Gemeinschaft“ mit einem neuen Partner (§ 1579 Nr. 2 BGB) sei der Gedanke der ehelichen Solidarität. Die dafür erforderliche „Abkehr aus der ehelichen Solidarität“ durch die Eingehung einer anderen, gleichsam die Ehe ersetzenden Partnerschaft könne sich bei nichtehelichen Partnern aber nicht ereignen.
Für den Unterhaltsanspruch der nichtehelichen Mutter gelte daher allein der Verwirkungsmaßstab des § 1611 BGB, wonach nur eine „grobe“ Unbilligkeit den Wegfall des Unterhaltsanspruchs rechtfertige. Eine solche ergebe sich nicht daraus, dass die Mutter in einer neuen, nichtehelichen Partnerschaft lebe.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 03.05.2019 – 2 UF 273/17